Vom Regen in die Traufe: Warum Apple keine Alternative zu Windows ist
Windows 10 läuft aus, doch der Wechsel zu Apple ist keine Lösung. Eine kritische Analyse.

Der Support für Windows 10 endet zwar nun doch erst 2026, zwingt aber dennoch viele Nutzer zum Handeln. Angesichts der restriktiven Hardware-Anforderungen und des zunehmenden Gängelungs-Kurses von Windows 11 erscheint der Wechsel zu Apple und macOS für viele als verlockende Alternative. Eine genauere Betrachtung zeigt jedoch, dass dieser Schritt lediglich den Tausch eines goldenen Käfigs gegen einen anderen, potenziell noch engeren bedeutet.
Der Mythos der Langlebigkeit
Gleich vorweg: Es gibt eine Tabelle, aus der man entnehmen kann, wann man sein Macbook entsorgen muss. Ja: Muss! Denn sobald es kein Update mehr gibt, werden z.B. die Zertifikate des Browsers nicht mehr aktualisiert. So kann man nach Support-Ende weder Surfen, noch Programme installieren oder sie sogar manchmal nicht mehr starten.
Beim aktuellen Betriebssystem kann man nachschauen, was das älteste Macbook ist, um zu erkennen, wie lange man ein Neugerät nutzen darf:
Ein häufiges Argument für Apple ist die vermeintliche Langlebigkeit der Geräte. Die Realität sieht aber eben anders aus. Apple gibt im Vorfeld keine wirklich transparenten Informationen über die Support-Dauer von macOS-Versionen für spezifische Hardware. Erfahrungswerte zeigen, dass Geräte im Schnitt fünf bis sieben Jahre nach ihrer Veröffentlichung mit Updates versorgt werden. Anhand welcher Kriterien Apple entscheidet, ein Gerät von zukünftigen Updates auszuschließen, bleibt ein gut gehütetes Betriebsgeheimnis.
Diese Praxis als “langlebig” zu bezeichnen, ist angesichts der Historie von Windows geradezu absurd. Bis zur Einführung der künstlichen Beschränkungen von Windows 11 lief Windows 10 problemlos auf über ein Jahrzehnt alter Hardware. Mit den neuen Anforderungen für Windows 11, die offiziell Intel-Prozessoren ab ca. 2017 und AMD-Prozessoren ab 2018 voraussetzen, sinkt Microsoft ironischerweise auf das Niveau von Apple herab. Eine Unterstützung von sieben bis acht Jahren wird hier zum neuen, unrühmlichen Standard.
Bei Apple müssen Nutzer also mit jeder neuen macOS-Version bangen, ob ihre oft noch voll funktionsfähige und leistungsstarke Hardware willkürlich aus dem Support fällt. Ein besonders drastisches Beispiel stellt der Übergang von Intel- zu den hauseigenen ARM-Prozessoren dar. Die 2024 erschienene Version macOS Sequoia wird die letzte sein, die Intel-Macs unterstützt. Ab 2025 werden Geräte, die teilweise erst 2018 bis 2020 auf den Markt kamen, keine neuen Betriebssystemversionen mehr erhalten.
Dass diese kurze Lebensdauer technisch nicht notwendig ist, beweist die Open-Source-Community eindrucksvoll. Der OpenCore Legacy Patcher ist ein Projekt von engagierten Nutzern, die sich gegen diese geplante Obsoleszenz wehren. Mit diesem Werkzeug ist es möglich, aktuelle macOS-Versionen auf Geräten zu installieren, die bis ins Jahr 2008 zurückreichen. Ein Team von nur etwa 35 Entwicklern schafft in seiner Freizeit, was ein Billionen-Dollar-Konzern angeblich nicht leisten kann. Es ist kein technisches Problem, es ist eine bewusste Geschäftsentscheidung.
Der goldene Käfig: Preispolitik und Monopol
Statt nachhaltiger Produktzyklen setzt Apple auf den Verkauf neuer Geräte. Da Apple als einziger Hersteller Geräte mit macOS produzieren darf, existiert kein freier Markt. Dieses Monopol wird seit Jahren gnadenlos ausgenutzt, um Preise zu diktieren, die jeglicher Relation zur Realität entbehren.
Ein Paradebeispiel sind die Aufpreise für Speicher-Upgrades. Werfen wir einen Blick auf die Konfiguration eines aktuellen MacBook Air:
- Ein Upgrade der SSD von 256 GB auf 512 GB kostet 230 € Aufpreis.
- Ein weiteres Upgrade von 512 GB auf 1 TB kostet ebenfalls 230 € Aufpreis.
Zum Vergleich: Eine hochwertige 1-TB-NVMe-SSD von Crucial kostet im freien Handel rund 60 €. Der Aufpreis für die Verdopplung von 500 GB auf 1 TB liegt hier bei wenigen Euro. Apple hingegen verlangt für dieselbe Kapazitätssteigerung das Vielfache – bei Einkaufspreisen, die durch die riesigen Abnahmemengen weit unter den Endkundenpreisen liegen. Das entspricht einem Aufschlag von weit über 1000%.
Man stelle sich vor, ein Cheeseburger bei McDonald’s kostet 2,50 €. Mit einer zusätzlichen Scheibe Käse würde der Preis nach Apples Logik auf über 25 € springen. Diese Preispolitik ist eine Gelddruckmaschine, die auf der gefangenen Kundschaft im eigenen Ökosystem aufbaut.
Gekauft, aber nicht im Besitz: Die Kontrolle über die Hardware
Wer glaubt, für den Premium-Preis wenigstens die beste und offenste Technik zu erhalten, wird enttäuscht. Apple schränkt die Kontrolle über die gekaufte Hardware massiv ein. Seit Jahren praktiziert der Konzern das sogenannte “Parts Pairing”. Dabei werden einzelne Komponenten wie Displays oder Kameras kryptographisch an die Seriennummer eines Geräts gebunden. Ein Tausch von Originalteilen zwischen zwei identischen Geräten führt zu Fehlermeldungen oder Funktionseinschränkungen, wenn die neue Komponente nicht durch Apple-autorisierte Software “freigeschaltet” wird.
Dies erschwert unabhängige Reparaturen enorm und treibt die Kosten in die Höhe. Die New York Times fasste es treffend zusammen: “Man bezahlt 1.000 Dollar für ein iPhone, aber es wird immer noch von Apple kontrolliert.”
Diese Kontrolle wurde in der Vergangenheit auch missbraucht, um Nutzer zum Neukauf zu bewegen. Apple wurde dabei erwischt, die Leistung älterer iPhones per Software-Update gezielt zu drosseln, angeblich um die Akkus zu schonen – ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Im goldenen Käfig bestimmt eben der Wärter die Regeln. Selbst systemeigene Apple-Anwendungen umgehen vom Nutzer eingerichtete Firewalls oder VPN-Verbindungen und entziehen sich so jeglicher Analyse und Kontrolle.
Die Fata Morgana der Privatsphäre
Eines der stärksten Marketing-Argumente von Apple ist der Schutz der Privatsphäre. “Was auf deinem iPhone passiert, bleibt auf deinem iPhone”, lautet das Credo. Doch auch dieses Versprechen wurde mehrfach gebrochen.
- 2016 wurde bekannt, dass Apple Anrufprotokolle heimlich und ohne Zustimmung der Nutzer auf iCloud-Server hochlädt.
- 2022 deckten Forscher auf, dass Apple die Privatsphäre-Einstellungen seiner Nutzer weitgehend ignoriert und selbst bei deaktiviertem Tracking detaillierte Nutzungsdaten über den App Store sammelt.

Den absoluten Tiefpunkt erreichte Apple jedoch 2021 mit der Ankündigung, eine clientseitige Überwachungstechnologie (CSAM Detection) auf allen Geräten zu implementieren. Geplant war, die privaten Fotos der Nutzer heimlich auf den Geräten zu scannen und bei Verdacht automatisch an Behörden zu melden. Dies wäre eine Massenüberwachung von nie dagewesenem Ausmaß gewesen und hätte eine gefährliche Hintertür für staatliche Zensur und Kontrolle geöffnet. Nach massiver öffentlicher Kritik wurde das Projekt zwar vorerst auf Eis gelegt, doch der Vertrauensbruch bleibt.
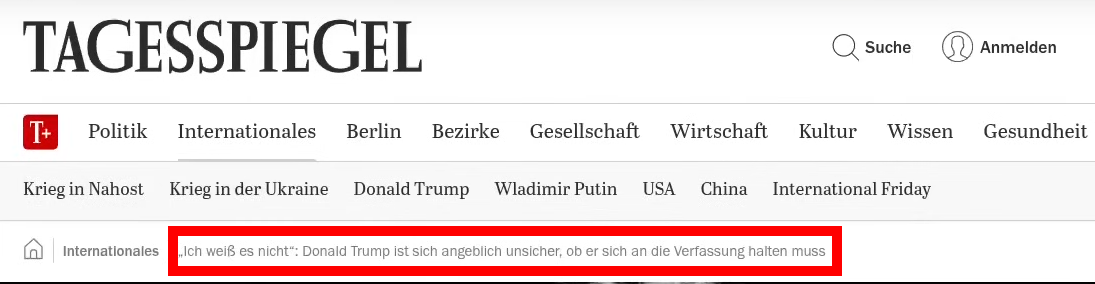
Edward Snowden kommentierte diesen Vorstoß mit den Worten: “Apple hat der Privatsphäre den Krieg erklärt.” Treffender kann man es nicht formulieren.
Die Wurzel des Problems: Proprietäre vs. Freie Software
Die Probleme bei Apple und Microsoft sind keine Zufälle, sondern systemimmanent. Beide Unternehmen vertreiben proprietäre, also unfreie Software. Das Geschäftsmodell basiert darauf, den Nutzer in einem geschlossenen Ökosystem zu halten, ihn zu kontrollieren und den Profit zu maximieren. Die Interessen des Unternehmens stehen immer über denen des Nutzers.
Wer sich aus der Abhängigkeit von Microsoft befreien will, findet bei Apple keine echte Alternative. Man tauscht lediglich einen Konzern gegen einen anderen aus und gerät in neue, teils noch restriktivere Abhängigkeiten. Die wahre Lösung liegt nicht im Wechsel des Anbieters, sondern im Wechsel des Systems.
Nur ein freies Betriebssystem wie GNU/Linux bietet echte Unabhängigkeit, Freiheit und Flexibilität. Hier hat der Nutzer die volle Kontrolle über seine Hardware und seine Daten. Statt den Regeln eines Konzerns unterworfen zu sein, kann man ein System nach den eigenen Bedürfnissen gestalten. Und wenn man sich sowieso an ein neues System gewöhnen will... Warum nicht Linux?
Fazit
Der Wechsel von Windows zu macOS ist ein Trugschluss, der die grundlegenden Probleme nicht löst, sondern nur verlagert. Geplante Obsoleszenz, monopolistische Preisgestaltung und ein gebrochenes Datenschutzversprechen zeigen, dass Apple keine Alternative, sondern nur eine andere Ausprägung des Problems ist. Wirkliche digitale Souveränität und nachhaltige IT sind nur mit freier und quelloffener Software zu erreichen.

